Kürzlich auf einem Spaziergang durch Frutigen bin ich dem Leimbach entlang Richtung Bahnhof gegangen. Ich wurde ein bisschen nostalgisch. Vis-à-vis sah ich die Mauer, auf der wir uns als Jugendliche an vielen Abenden getroffen haben. Für uns war das ein idealer Platz: Man konnte sich etwa in die Mitte zwischen den beiden Brücken setzen und sah von weither, ob jemand in die Nähe kam. Längst genug Zeit eine verbotene Zigarette auszudrücken. Längst genug Zeit, ein heikles Gesprächsthema zu unterbrechen. Dass man im Dunkeln auch die Zigarettenglut von weither sehen konnte, wurde uns erst bewusst, als wir bereits erwischt waren.
In meiner letzten Kolumne habe ich von der Reitschule in Bern erzählt. Und bei jenem Spaziergang durch Frutigen, ging mir ein weiterer Aspekt auf, der in diesem Thema wohl auch eine Rolle spielt.
Ich denke an die bedeutenden Schauplätze meiner Jugendjahre in Frutigen. Vielleicht erinnern Sie sich an den Schopf oberhalb des Hotel Terminus? Es hat dort auch einmal gebrannt. Ein dreckiger Holzschuppen mit einer Matratze auf dem Boden, der kaum andere Vorzüge zu bieten hatte, als dass er ein Versteck war. Sich im Schopf zu treffen hatte etwas Anrüchiges, viele Eltern wussten nichts von der Lokalität. Bei nicht wenigen war der Schopf verboten, weil sich herumgesprochen hatte, dass wir uns dort Freiheiten nahmen, die man uns explizit nicht gegeben hatte. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass gerade diese Verbote den Reiz hinzugehen noch vergrösserten.
In meinem Freundeskreis hatten wir noch einen weiteren Lieblingsort: Auf dem Areal des Güterbahnhofs stand ebenfalls ein Schopf, dort wurde Heu gelagert und wenn man sich nur zu zweit oder zu dritt traf, fand man darin ein gemütliches Lager um stundenlang den pubertären Herzschmerz und die verbohrten Grundsätze der Erwachsenen zu beklagen. Wir mussten das sehr leise tun, denn der Spazierweg zum Bahnhof war nahe und als uns der Schopfbesitzer einmal erwischt hatte, hatte er tüchtig geschumpfen. Wir lernten daraus, unseren Abfall in Zukunft mitzunehmen und kamen unbeeindruckt wieder. Auch bei diesem Treffpunkt hätten nüchtern betrachtet die Nachteile überwiegen müssen, und auch bei diesem Treffpunkt war das genau sein Reiz. Wir wollten nicht immer auf der Pony-Terrasse sitzen. Lieber unter Entdeckungsgefahr über den Zaun klettern, das Areal durchqueren und das Tor zum Schopf aufschliessen. Spielplätze interessierten uns höchstens bei Nacht. Lieber eine improvisierte Feuerstelle auf dem Dach des Wasserreservoirs oben im Guferwald, als 20 Meter darunter den offiziellen Brätelplatz zu benutzen.
Später zog es uns ins Mokka nach Thun. Auch das war nicht gern gesehen zuhause (Kifferhöhle!) und das war gut so: Wir wollten uns einen Freiraum erobern. Im Übermut der jugendlichen Rebellion glaubten wir, uns selber zu sein, bedeute zwingend, gerade anders zu sein als die Erwachsenen das von uns wollten. Dass es natürlich auch in der alternativen Jugendkultur eine gewisse Gleichschaltung gibt, wurde uns erst mit einigen Jahren Abstand bewusst: Auch Stahlkappenschuhe und Kapuzzenpullis können eine Uniform sein.
Wenn ich heute spätabends über den Vorplatz der Reitschule gehe und die übermütigen Jugendlichen beobachte, viele zwischen 15 und 19, dann bin ich eigentlich ganz dankbar, dass ich meine Spätpubertät noch auf dem Land verbringen durfte, wo wir uns in Wäldern verstecken konnten. Ich beneide die Stadtjugend nicht. Und vielleicht müsste man Pädu Anliker im Mokka und den Reitschulbetreibern neben Kulturförderung auch noch ein zweites Kerngeschäft vergüten: Eine Jugendarbeit, vor der sich die Jugend nicht versteckt. Der RESPECT-Schriftzug vor dem Mokka, der „Kein Sexismus, kein Rassismus, kein Deal“-Slogan der Reitschule, das sind gute und wichtige Werte, die einem dort weitgehend glaubwürdig vorgelebt werden und die sich bei mir mindestens so nachhaltig festgesetzt haben wie manche (natürlich oft ebenso gute und wichtige) Erziehungsversuche der traditionellen Autoritäten.

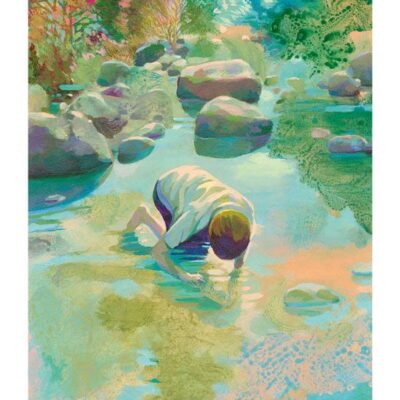



Schreibe einen Kommentar