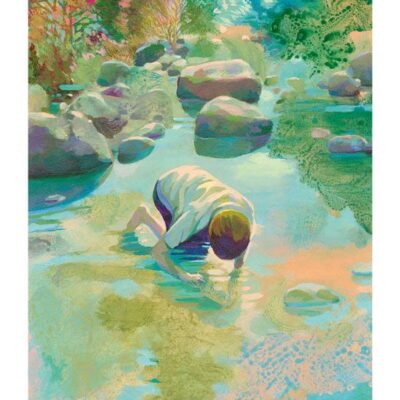City of Chance
Die Zeit fliegt in dieser Stadt. (Andererseits: Wo nicht?)
Ich will versuchen, diesmal etwas darüber zu schreiben, wie die Leute, die ich hier kennen lerne an ihren „Karrieren“ arbeiten. Zu diesem Zweck erlaube ich mir zu Beginn etwas auszuschweifen:
Ich lese viel Paul Auster, seit ich in New York bin. Auster lebt seit Jahren in Brooklyn, und hat neben seinen berühmten Romanen wie „The New York Trilogy“, „Moon Palace“ und „Timbuktu“ auch das Drehbuch für den Raucher-Kultfilm „Smoke“ geschrieben und bei „Lulu on the Bridge“ Regie geführt. Sein Werk ist eng verbunden mit New York, mit Brooklyn insbesondere, und er gilt als einer jener zeitgenössischen US-Autoren, die die Zeit überdauern werden.
Bei meinem ersten Kontakt mit einem seiner Bücher war ich etwas befremdet von der grossen Rolle die Zufälle in seinen Geschichten spielen. Viele der gewichtigsten Entwicklungen in seinen Geschichten kommen durch unwahrscheinliche Ereignisse ins Rollen, Figuren verhalten sich hochgradig irrational, Leute werfen mit einem impulsiven kleinen Schritt in eine unbekannte Richtung ihr ganzes Leben über den Haufen. Die Dinge scheinen keine tiefer liegende Begründung zu haben, aber sie überfallen unser Leben auf unerwartete Weise und verändern es nachhaltig und zurückschauend versucht man sich, seine Geschichte zu erklären und steht bloss ratlos da, weil man feststellt, dass sie einem schlicht passiert ist, das ist das Leben in Paul Austers Büchern: Es passiert seinen Figuren und es widersetzt sich störrisch einer kausalen Erklärung. Was seine Protagonisten, in all ihrer Hilflosigkeit, nicht daran hindert, viel über sich selber zu lernen.
Nach einiger Zeit in dieser Stadt beginnt man es besser zu verstehen. New York is a city of chance. Man kann diesen Satz nicht wirklich übersetzen. Das englische„Chance“ bedeutet sowohl „Möglichkeit, das etwas passieren könnte“, entsprechend unserem franko-deutschen „Chance“, es bedeutet aber auch „glücklicher Zufall“: „I ran into him by chance“, „Ich hoffte ihn zu sehen und bin ihm zufällig begegnet.“
Es passiert einem dauernd: Mindestens fünf Mal habe ich versucht mich mit meinem britischen Kumpel Paul zu treffen und nichts hat so geklappt, wie es sollte, ich stand an irgendeiner Ecke in Chelsea und wusste nicht, wie ihn nun finden sollte, da er kein Telefon hatte, und da kommt er dahergelaufen, als ob wir tatsächlich da abgemacht hätten.
Die beiden Schweizer, die im Moment in der Kulturwohnung der Stadt Bern wohnen, treffe ich irgendwo weit weg von ihrer Nachbarschaft an einem U-Bahnhof in Brooklyn.
Die neuen Freunde aus der Sidewalk-Szene erzählen dieselben Geschichten: Wie sie zwei Mal am gleichen Tag mit einem alten Bekannten von viel viel früher in denselben U-Bahn-Wagon steigen. Auf demselben Zug zu sein ist eigentlich schon erstaunlich genug, und die Züge sind lang hier…
Andererseits ist es auch nicht derart überraschend, in der Schweiz ist es nichts Besonderes, man ist eher erstaunt, wenn man den üblichen Verdächtigen mal eine Woche lang nicht begegnet. Aber in New York, dieser in jeder Hinsicht enormen Stadt, wird es einem stärker bewusst, weil die Unwahrscheinlichkeit proportional zum Schauplatz der Zufälle wächst: Das Leben, oder Gott, das Schicksal, wieauchimmer man es nennen will, es denkt sich Grossartiges aus, um Leute (wieder und wieder) zusammenzubringen, und während man sich in der kleinen Schweiz manchmal wünscht, man könnte davor flüchten, weil es geradezu unausweichlich ist, schärft es hier das Bewusstsein dafür, wie ausgeliefert man dem Lauf der Dinge eigentlich ist, wie lächerlich Strategien sein können. Und es wächst die Bereitschaft, sich da einfach reinzuschicken, sein Bestes zu geben, hoffnungsvoll zu erwarten, was kommen könnte.
MySpace, die Underground-Strategie
Diese Ausgangslage bestimmt viel im Alltag der Musiker hier in New York. Es gibt nur eine sichere Strategie: Viel Geld. Für viel Geld kann man sich Publizisten kaufen, die einem in die Zeitungen bringen, die dafür sorgen, dass man öffentliche Präsenz hat und damit immer genug Publikum bei den Auftritten. Das ist der „Draw“, it’s all about the draw, den „Zug“, den man hat: Die Clubs führen Listen, wie viele Leute zu den Konzerten kommen. Eine Karriere beginnt in jenen Clubs, die kein Eintrittsgeld verlangen, die Künstler werden mit Trinkgeld bezahlt, die Shows dauern 30 bis 45 Minuten, Orte wie das Sidewalk Café, The Living Room, Pianos, Rockwood Music Hall und viele andere. Wenn sich ein Act dort bewährt und regelmässig genug Publikum zieht, wird er früher oder später in den etwas schwierigeren Venues gebucht: Mercury Lounge, Sin-é (schon lange nicht mehr das kleine Café in dem Jeff Buckley gross geworden ist), Tonic, Arlenes Grocery Store, Makor und viele andere. Das bedeutet noch lange nicht, dass man Geld verdient: Beim Eingang muss der Besucher angeben, welchen Act er sehen will, und die Band bekommt einen Anteil von dem ausbezahlt, was dank ihr eingenommen wurde. Das mag nach Ausbeutung der Künstler klingen, ist aber bei genauerer Betrachtung fair: In Dutzenden von Clubs gibt es Abend für Abend drei bis fünf Konzerte, wenn ein Act also wirklich arbeitet, sich Mühe gibt, die Leute abzuholen und etwas zu bieten, findet er auch eine Plattform, es zu tun. Verhätschelt wird hier niemand. Die Clubs ihrerseits halten sich mit Drink-Minimums über Wasser, für deren Einhaltung resolutes Servicepersonal sorgt. Es ist viel Idealismus im Spiel hier, egal ob man spielen, veranstalten oder bedienen will. Wer es gemütlich mag, überlebt in New York nicht lange. Entsprechend viele Geschichten werden erzählt von jenen, die s nicht geschafft haben. Immer wieder höre ich meine Freunde: „So where’s Scott these days? I haven’t seen him in a while.“
„Oh, he went back to South Dakota.”
“Really? What for?”
“Ran out of money. Couldn’t make it anymore.”
Und dann ein wissendes Nicken.
Der „Draw“ ist also in gewisser Weise etwas Käufliches, denn im konstanten Überangebot, das New York einem an jedem Abend der Woche in allen Sparten bietet, ist öffentliche Präsenz das Ein und Alles. Die Meisten können sich freilich keinen Publizisten leisten und haben andere Tricks entwickelt. Es wird manisch geflyert, immer wieder kriegt man bei Konzerten oder auch nur im Foyer stehend eine Gratis-CD in die Hand gedrückt. Die mächtigste Waffe der finanziell Machtlosen ist aber das Internet, insbesondere die Plattform MySpace.com. Bei vielen Auftritten wird man aufgefordert, Mailinglisten zu unterschreiben. MySpace.com ist in jüngster Vergangenheit auch in Europa zu einigem Ruhm gekommen, weil die britischen Newcomer Arctic Monkeys über diese Plattform ihre Karriere lanciert haben. Das Prinzip ist simpel: Jeder, egal ob Musiker oder Schauspieler oder Privatperson, kann gratis eine Seite einrichten, und man kann seine eigenen Songs in einem integrierten MP3-Player zum anhören und downloaden anbieten. Wenn man jemanden als MySpace-Freund auf seine Seite einlädt und er akzeptiert, ist man in einem gemeinsamen Network, das auch als rudimentäres E-Mail-Programm verwendet werden kann. Viele Private nutzen MySpace als Dating-Plattform, viele Künstler versenden so ihre Konzertwerbung, es gibt kaum noch eine Band, einen Club, inklusive der Grossen, die nicht auf MySpace präsent sind. Claire Bowman, die Back-Up-Sängerin und Managerin der Sidewalk-Darlings The Bowmans, hat schon mehrere mehrmonatige Touren so organisiert: Sie kontaktiert über MySpace in allen Städten Acts, die für ähnliche Musik stehen und wenn man sich versteht und mag, hilft man sich aus. Claire organisiert ihnen Gigs in New York, die Bowmans kriegen einen Auftritt in der jeweiligen Heimatstadt der Band. Das ist eine immense Arbeit, aber sie basiert auf persönlichen Kontakten und ist wahrhaftig „Indie“. Es existiert also ein echte Musik-Subkulturszene, die von den traurigen Mechanismen der Mainstream-Industrie mehr oder weniger unberührt bleibt. Nichtsdestotrotz hoffen die meisten Acts auf einen Durchbruch in eine Ausgangslage, in der sie tatsächlich etwas verdienen würden. Die ganze Arbeit hat also zum Ziel, schlussendlich zu einer Bedeutung zu kommen, die auch von den Labels wahrgenommen wird. Es heisst: Wer bei New York-Shows öfters mehr als hundert Leute anzieht, hat auch die A&R-Leute regelmässig dabei. Und: Auch die Industrie hat inzwischen erkannt, wie machtvoll MySpace ist. Die Bowmans mit ihren über 3000 MySpace-Friends wurden kürzlich von V2 kontaktiert. Natürlicherweise wird auch das missbraucht: Man kann inzwischen bei eBay Accounts kaufen: „Selling MySpace-Account with 5000 Friends“ heisst es dann da.
Ron Haney, Sänger und Gitarrist bei den international spielenden Churchills, erklärt mir, wenn man auswärts spiele und 1000 Leute über MySpace einlade, würden möglicherweise 50 kommen. Möglicherweise.
Der erste Gig in New York City
Als ich am 19.März die Bühne des Sidewalk Cafés betrete habe ich 90 MySpace-Freunde eingeladen, unter den 20-30 Leuten im Publikum sind einige Schweizer, einige Übriggebliebene von der Show Ben Godwins, der direkt vor mir gespielt hat, einige meiner engsten Sidewalk-Bekannten. Viele, deren Shows ich besucht habe, und die mir nun eigentlich auch einen „Gefallen“ schulden würden, fehlen. Andererseits gelten 20 Leute an einem Sonntagabend um 11 als ganz okay, besonders für eine erste Show. Es läuft nicht schlecht, ich spiele vor allem die neuen Songs, die ich New York geschrieben habe, kämpfe ein wenig mit einem Husten, den ich mir in der Kälte der vorigen Wochen geholt habe, meinem ersten in der Stadt (er bricht dann zum Glück gar nie richtig aus). Interessant für mich: Die Bühnenperson, die ich mir für die Auftritte in der Schweiz über die Jahre zugelegt habe, funktioniert nur bedingt. Ich bin mir gewohnt, dem Publikum einen Einstieg in die Songs zu geben, einen kleinen Hinweis auf den folgenden Inhalt, damit sie den englischen Texten nicht allzu hilflos gegenüberstehen. Das ist hier nicht nur unnötig, sondern grenzt an Publikumsbeleidigung. Oder Unsicherheit: Wenn der Song gut ist, warum sollte er eine Erklärung brauchen? Das habe ich in den Wochen der OpenMikes gelernt, bei meinem ersten längeren Auftritt kommt es mir nun aber doch wieder in die Quere. Das lustige Lied, das ich extra für den Auftritt geschrieben habe, über meine ersten Wochen in der Stadt, gewinnt zwar einige Lacher (vermutlich vor allem von den Schweizern, die Ähnliches erlebt haben), wird aber von meinen amerikanischen Vertrauten eher als Tiefpunkt gewertet. Warum? Sie merken sofort, dass es nicht „genuine“ ist, also nicht das, was mich als Songwriter ausmacht. (Das stimmt wohl auch, ich bin nicht lustig…) Dieser Anspruch begegnet mir immer wieder und er fasziniert mich. Viele meiner „Peers“ hier sind wahrhaftig unberührt geblieben von den kommerziellen und gefallsüchtigen Überlegungen, die einem als auftretendem Künstler so schnell das eigene Werk infiltrieren.
Alles in allem ist der Auftritt und das daraus resultierende Feedback aber ermutigend, und als direkte Konsequenz werde ich diese Woche bei zwei Shows als Gast mitspielen können und für April sind inzwischen drei weitere Gigs rein gekommen, so dass ich nun eigentlich gar nichts mehr annehmen könnte für April, wenn ich nicht meinen „Draw“ ruinieren will. Nett ist aber, dass dank den guten Verbindungen, die ich zu einigen Klein-Prominenten auf der Szene aufbauen konnte (lauter Leute, die ich „by chance“ immer wieder getroffen habe), andere Dinge wie von selber ins Rollen kommen: Ein lokales Internetradio fragt an, ob ich Songs zu spielen hätte; eine Veranstaltungsreihe bietet von sich aus einen Slot an und ähnliches. Nichts was ich überbewerten sollte, angesichts der zahllosen talentierten Leute, die dasselbe mit demselben (oder mehr) Erfolg tun, dennoch ein Zeichen, dass Türen aufgehen können, wenn man dranbleibt und seine Chancen nutzt.
Ich stehe nun vor meinem letzten Monat hier. Inzwischen verbringe ich die meiste Zeit damit, mich zu informieren, wie ich legal für längere Zeit zurückkommen könnte. Gedanken auch darüber, was zuhause aus den Erfahrungen werden wird, die ich von hier mitnehme. Ob ein OpenMike in Bern funktionieren würde? Ob ich den AntiFolkern Shows in der Schweiz organisieren könnte.
Ob ich einfach Ende April untertauchen soll in Brooklyn und meinem Flugzeug winken und weiterwursteln und abwarten, bis mich die Polizei (die überall ist) irgendwo kontrolliert und ausschafft… Just kidding…
Ps: Ein paar MySpace-Tipps: